Übergeben Sie mir Ihr Konto, ich handle und profitiere für Sie.
MAM | PAMM | LAMM | POA
Forex-Prop-Firma | Vermögensverwaltung | Große Privatfonds.
Offizieller Start ab 500.000 US-Dollar, Test ab 50.000 US-Dollar.
Gewinne werden zur Hälfte (50 %) und Verluste zu einem Viertel (25 %) geteilt.
Foreign Exchange Multi-Account Manager Z-X-N
Akzeptiert den Betrieb, die Investitionen und die Transaktionen globaler Devisenkontoagenturen
Unterstützen Sie Family Offices bei der autonomen Vermögensverwaltung
Devisenbanken benachteiligen Großinvestoren nicht.
Im Devisenhandel benachteiligen Devisenbanken Großinvestoren nicht. Der Grund, warum sie von diesen Investoren bei Einzahlungen einen Herkunftsnachweis verlangen, selbst wenn die Gelder von den zehn größten Banken weltweit stammen, liegt in der umfassenden Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Dazu gehören die Einhaltung nationaler und internationaler Finanzmarktregulierung und die Kontrolle der eigenen operationellen Risiken. Die interne Logik lässt sich aus mehreren Perspektiven betrachten.
Erstens dient sie der Einhaltung der strengen nationalen und internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderer damit verbundener regulatorischer Anforderungen. Als Finanzinstitute, die direkt von nationalen Finanzmarktaufsichtsbehörden reguliert werden, müssen Devisenbanken die einschlägigen regulatorischen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strikt umsetzen. Unter den verschiedenen Arten von Finanzmitteln sind große Geldsummen stets das Hauptziel illegaler Finanzaktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daher ist die Anforderung eines Herkunftsnachweises für Großinvestoren eine entscheidende Maßnahme für Devisenbanken, um ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Dieses Verfahren stellt effektiv sicher, dass die Gelder nicht aus illegalen Quellen wie Drogenhandel oder Schmuggel stammen und verhindert somit, dass die Bank zu einem Kanal für die Legalisierung illegaler Gelder wird. Verstöße gegen diese Vorschriften ziehen hohe Geldstrafen, Einschränkungen der Lizenznutzung und eine Reihe schwerwiegender Sanktionen nach sich, die das Kerngeschäft der Bank erheblich beeinträchtigen.
Zweitens muss das Risikomanagement dem operativen Umfang der Bank entsprechen. Im Vergleich zu großen multinationalen Banken verfügen die meisten Devisenbanken über einen relativ geringen operativen Umfang. Hohe Kapitalzu- und -abflüsse üben erheblichen praktischen Druck auf die operativen Kernbereiche von Devisenbanken aus, wie beispielsweise das Fondsmanagement und die Liquiditätsallokation. Noch wichtiger ist, dass Devisenbanken, wenn diese großen Geldsummen Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten sind oder von Aufsichtsbehörden als illegal eingestuft werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit in komplexe rechtliche Untersuchungen verwickelt werden und sogar schwerwiegenden Risiken wie dem Einfrieren von Geldern ausgesetzt sein können. Solche Situationen können ihr gesamtes operatives System massiv beeinträchtigen. Durch die vorherige Überprüfung der Herkunft großer Gelder können Devisenbanken diese potenziellen Risiken effektiv herausfiltern und so die Stabilität und Kontinuität ihrer Geschäftstätigkeit gewährleisten.
Darüber hinaus dient dies der Klärung von Transaktionsgrenzen und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und die Rechte der Anleger. Die meisten Devisenbanken legen vierteljährliche Einlagenlimits fest. Transaktionen innerhalb des Limits können gemäß dem regulären Verfahren automatisch verarbeitet werden, während Transaktionen über dem Limit die Bereitstellung zusätzlicher Informationen durch die Anleger, wie beispielsweise einen Nachweis über die Herkunft der Gelder, erfordern. Dieser Mechanismus ist keine speziell für Großinvestoren konzipierte Beschränkung; sein Hauptzweck ist die klare Unterscheidung zwischen regulären und Sondertransaktionen. Schließlich können auch hohe Geldsummen, die von etablierten Banken überwiesen werden, aus besonderen Quellen stammen, etwa aus Erbschaften oder Immobilienverkäufen. Der Nachweis der Herkunft der Gelder trägt zur Klärung ihrer Rechtmäßigkeit bei. Aus Sicht der Bank bildet diese Anforderung die Grundlage für ihren Transaktionsprüfungsprozess und beugt so effektiv Rechtsstreitigkeiten vor, die durch Zweifel an der Herkunft der Gelder entstehen könnten. Für den Anleger verhindert diese Maßnahme, dass hohe Geldsummen nach Betrug oder Kontoübernahmen auf die Bank fließen und schützt somit indirekt dessen Gelder.
Letztendlich dient dies der Vereinheitlichung der Standards im Kundenmanagement und der Vermeidung potenzieller Regellücken. Da Devisenbanken typischerweise Finanzdienstleistungen für Kunden in den meisten Ländern weltweit anbieten, würde eine Lockerung der Prüfstandards für hohe Geldsummen allein aufgrund ihrer Herkunft von etablierten Banken zwangsläufig erhebliche Lücken in ihren Geschäftsregeln schaffen. Beispielsweise könnten illegale Gelder über Zwischenkonten bei etablierten Banken transferiert werden, bevor sie auf Devisenbankkonten gelangen, um ihren illegalen Charakter zu verschleiern. Unterschiedliche Prüfstandards würden solche Verstöße begünstigen. Daher kann die einheitliche Anforderung eines Herkunftsnachweises für alle größeren Summen, die den Grenzwert überschreiten, regulatorische Umgehungen wirksam verhindern, einheitliche Prüfstandards für alle Anleger gewährleisten und somit die Fairness von Finanzdienstleistungen und die Strenge von Geschäftsabläufen wahren.
Im Devisenhandel haben sich Pending Orders mit ihrer einzigartigen Handelslogik als hochwertige Lösung etabliert, um Händlern zu helfen, die menschliche Schwäche der Ungeduld zu überwinden. Ihr intrinsischer Wert lässt sich anhand von Beispielen aus der Praxis, die menschliche Eigenschaften berücksichtigen, eingehend analysieren.
Im Alltag ist Warten ein weit verbreitetes Verhalten. Man wartet beispielsweise stundenlang auf die Erledigung einer Angelegenheit, ohne dass die betreffende Person erscheint. Händler hingegen müssen oft warten, insbesondere wenn sie dringend etwas benötigen. Sie müssen zudem Frustration und Ärger unterdrücken und Geduld vortäuschen. Dieser passive und langwierige Warteprozess führt oft zu einem starken Gefühl der Verzweiflung und Angst. Diese menschliche Eigenschaft verstärkt sich im Devisenhandel und wirkt sich negativ aus.
Betrachtet man den Devisenmarkt mit seinen zweiseitigen Handelsmöglichkeiten, so ist eines der Hauptprobleme vieler verlustbringender Trader ihre Unfähigkeit, rational abzuwarten. Sie sind stets bestrebt, Positionen zu eröffnen, kurzfristige Gewinne zu erzielen und diese schnellstmöglich zu schließen. Selbst wenn ihre Einschätzung des allgemeinen Markttrends völlig richtig ist, fällt es ihnen schwer, kurzfristige Verluste während der Haltedauer zu tolerieren. Oft schließen sie Positionen vorzeitig, bevor sich der Trend vollständig entwickelt und das Gewinnpotenzial ausgeschöpft hat, und verpassen so letztendlich erhebliche Gewinne. Die Ursache für dieses Verhalten liegt in der menschlichen Ungeduld.
Genau aufgrund dieses Problems im Handel wird der Wert von Pending Orders deutlich. Sie stellen eine hervorragende Methode dar, um der menschlichen Ungeduld entgegenzuwirken. Im realen Handel können Trader mithilfe von Pending Orders auf vorteilhafte Einstiegspunkte warten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Markt ständig zu beobachten, und impulsive, emotional getriebene Einstiege werden vermieden. Pending Orders sichern zudem optimale Ausstiegspunkte und verhindern so vorzeitige Gewinnmitnahmen oder Stop-Loss-Orders aufgrund emotionaler Unausgewogenheit durch Marktschwankungen. Noch wichtiger ist, dass Trader durch das Platzieren mehrerer kleiner Pending Orders das quälende Warten auf Kursverluste bei großen Positionen effektiv vermeiden können. Dies diversifiziert das Handelsrisiko und reduziert den psychologischen Druck, der durch starke Schwankungen einer einzelnen Position entsteht.
Für Trader, die ihre Handelsfähigkeiten weiterentwickeln möchten, bedeutet das Erlernen und Beherrschen der Logik und Techniken des Pending-Order-Handels einen entscheidenden Durchbruch in ihrer Denkweise und ihrem operativen System. Sie erwerben damit die Kernkompetenzen für stabile Gewinne im Devisenmarkt und machen einen wichtigen Schritt zum Handelserfolg.
Im Bereich des bidirektionalen Devisenhandels sind MAM (Multi-Account Management) und PAMM (Percentage Allocation Management) im Wesentlichen Managed-Services-Systeme. Dieser Mechanismus wird jedoch von den Aufsichtsbehörden in den meisten Teilen der Welt nicht anerkannt.
Devisenaufsichtsbehörden in Ländern wie den USA, Japan und Frankreich haben dieses Geschäftsmodell ausdrücklich abgelehnt. Der Hauptgrund dafür ist, dass dieser Mechanismus äußerst anfällig für vielschichtige Risiken und Probleme ist. Dazu gehören die Beeinträchtigung von Anlegerrechten, Schwierigkeiten bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und Verstöße gegen Compliance-Richtlinien. Die zugrunde liegende Logik lässt sich auf verschiedenen Ebenen analysieren.
Erstens ist der Schutz von Anlegerrechten unter diesem Mechanismus extrem schwierig, und die potenziellen Risiken sind sehr hoch. Bei den Betriebsmodellen MAM und PAMM müssen Anleger die Verwaltung ihrer Gelder vollständig den Fondsmanagern anvertrauen. Ihre Gewinne und Verluste hängen ausschließlich von deren fachlicher Kompetenz und ethischen Grundsätzen ab. Viele Fondsmanager auf dem Markt verfügen jedoch nicht über die notwendigen Qualifikationen, was eine ernsthafte Gefahr für die Kapitalsicherheit der Anleger darstellt. Beispielsweise wenden einige unqualifizierte Manager im Streben nach kurzfristig hohen Renditen übermäßig aggressive Handelsstrategien an und hebeln ihre Positionen blindlings für hohe Handelsaktivitäten aus. Bei einer Trendwende am Devisenmarkt erleiden die Anleger dadurch enorme Verluste. Schlimmer noch: Manche kooperieren mit Forex-Brokern, um sich illegal zu bereichern, indem sie beispielsweise betrügerische Orderplatzierungen nutzen, um hohe Provisionen zu erzielen, oder Handelsaufzeichnungen fälschen, um direkt das Kapital und die Gewinne der Anleger abzuschöpfen. Gleichzeitig haben Anleger unter diesem Mechanismus nur äußerst geringe Kontrolle über den Handelsprozess. Die Details der Orderzuweisung und der Risikokontrolllogik von MAM und PAMM sind relativ komplex, sodass es für Privatanleger schwierig ist, verdächtige Transaktionen selbst zu erkennen. Darüber hinaus ist es bei Verlusten oft schwierig, Fondsmanager oder Broker zur Rechenschaft zu ziehen, da die Haftungsbestimmungen unklar sind und die Beweiskette schwer nachzuweisen ist. Genau deshalb hat Japan im Finanzinstrumente- und Börsengesetz explizite Bestimmungen erlassen, die es nicht qualifizierten Unternehmen untersagen, fremdes Vermögen zu verwalten. Hauptziel ist es, das häufige Auftreten solcher Vorfälle, die Anlegerrechte schädigen, zu verhindern.
Zweitens ist das traditionelle Regulierungssystem für die Funktionsweise dieses Mechanismus ungeeignet und führt leicht zu regulatorischen Lücken. Die einzigartigen Handelsmodelle und Kapitalflüsse von MAM und PAMM stellen eine erhebliche Herausforderung für den traditionellen Devisenregulierungsrahmen dar. Zum einen besteht das Problem der unklaren Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den verschiedenen Parteien im gesamten Fondsmanagementprozess. Forex-Broker behaupten oft, lediglich Handelsplattformen bereitzustellen und nicht an den eigentlichen Handelsentscheidungen beteiligt zu sein, während Fondsmanager für die konkrete Handelsausführung verantwortlich sind. Im Falle eines Verstoßes oder eines Risikoereignisses können beide Parteien die Verantwortung leicht abwälzen, was es den Aufsichtsbehörden erschwert, den Hauptverantwortlichen schnell zu identifizieren und die regulatorische Bearbeitung zu erschweren. Andererseits zeichnet sich dieser Mechanismus durch plattform- und regionenübergreifende Operationen aus. Einige Fondsmanager eröffnen bewusst Konten bei Brokern, die in Regionen mit laxen Regulierungen registriert sind, um Gelder von Anlegern aus anderen Ländern zu erhalten. Diese grenzüberschreitenden Transaktionen umgehen die regulatorischen Grenzen einzelner Länder und machen es den Aufsichtsbehörden unmöglich, Geldflüsse umfassend und in Echtzeit zu verfolgen und Transaktionsdaten vollständig zu erfassen. Dies bietet Möglichkeiten für illegale Finanzaktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Frankreich hat beispielsweise explizite Vorschriften erlassen, die es Unternehmen ohne entsprechende Zulassung untersagen, Anlegergelder über die Mechanismen MAM oder PAMM entgegenzunehmen und Handelsgeschäfte zu tätigen. Dadurch wird verhindert, dass regulatorische Schlupflöcher von illegalen Akteuren ausgenutzt werden.
Darüber hinaus ist dieser Mechanismus in hohem Maße anfällig für Verstöße gegen die Anforderungen an die Finanzaufsicht und das Qualifikationsmanagement in einigen Ländern. Die meisten Länder mit strengen Devisenmarktregulierungen haben hohe Qualifikationsstandards für Vermögensverwaltungsdienstleistungen festgelegt, und die Mechanismen MAM und PAMM können diese regulatorischen Bestimmungen in der Praxis leicht umgehen. Am Beispiel des US-Marktes lässt sich zeigen, dass Institute, die Managed Trading Services anbieten, eine CTA-Qualifikation (Commodity Trading Advisor) benötigen. In Großbritannien müssen Anbieter von Managed Trading Services über eine professionelle Investmentmanager-Qualifikation verfügen und mit Investoren und Brokern Compliance-Vereinbarungen mit mehreren Parteien abschließen. Diese regeln den Umfang der Autorisierung, die Gebührenstruktur und die Definition der Risikotragung. In der Praxis erhalten jedoch viele MAM- und PAMM-Fondsmanager lediglich eine eingeschränkte Kontoführungsberechtigung über Forex-Broker, bevor sie direkt im Managed Trading tätig werden, ohne die von den Aufsichtsbehörden geforderten Compliance-Qualifikationen zu erwerben. Dieses Vorgehen verstößt direkt gegen die lokalen Finanzvorschriften. Für die Aufsichtsbehörden käme die Anerkennung der Compliance von MAM- und PAMM-Mechanismen einer Duldung unqualifizierter Finanzdienstleister gleich und würde die Qualifikationsordnung des Finanzmarktes massiv stören. Daher verweigern sie ihnen die Konformität.
Schließlich führen die systembedingten Schwachstellen der Handelsmechanismen selbst leicht zu Marktvolatilität und Handelsstreitigkeiten. Die Handelsallokationslogik von MAM und PAMM weist unvermeidbare Mängel auf, die sowohl auf Handels- als auch auf Marktebene vielfältige Probleme verursachen können. Am Beispiel des PAMM-Mechanismus lässt sich zeigen, dass dessen Funktionsweise darin besteht, die Gelder aller teilnehmenden Anleger in einem einzigen Handelskonto zu bündeln. Zieht ein Großinvestor während einer laufenden Position Gelder ab, stört dies die gesamte Risikomanagementstrategie erheblich, beeinträchtigt die Interessen kleinerer Anleger und kann zu Handelsstreitigkeiten zwischen den Gruppen führen. Der MAM-Mechanismus nutzt zwar separates Copy-Trading, ist aber in der Praxis sehr anfällig für Kopierfehler. Werden Batch-Orders gleichzeitig platziert und ausgeführt, können sie zudem innerhalb kurzer Zeit einen konzentrierten Schock im Marktpreis bestimmter Währungspaare verursachen und so den normalen Handelsablauf am Devisenmarkt stören. Darüber hinaus werden einige MAM- und PAMM-Mechanismen in Verbindung mit automatisierten Expert Advisors (EAs) eingesetzt. Diese Handelsmodelle zeichnen sich oft durch hohe Handelsfrequenz und hohe Hebelwirkung aus, was das finanzielle Risiko einzelner Anleger deutlich erhöht und die Unsicherheit des gesamten Devisenmarktes steigert. Dies widerspricht den regulatorischen Zielen einiger Länder, die einen stabilen Devisenmarkt anstreben. Aus diesem Grund lehnen die zuständigen Aufsichtsbehörden diesen Mechanismus ab.
In London, Sydney, Nikosia, Frankfurt und sogar Dubai gelten MAM und PAMM nicht grundsätzlich als verwerflich. Die Aufsichtsbehörden haben sich für einen transparenten und nachvollziehbaren Zugangsweg mit hohen Hürden entschieden und aggregierte Konten in den bestehenden Rahmen für die Vermögensverwaltung integriert, anstatt ein Verbot zu verbieten.
Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) betrachtet Managed Accounts als „regulierte Tätigkeiten von Vermögensverwaltern“. Jede natürliche oder juristische Person muss zunächst eine Zulassung für die „Portfolioverwaltung“ gemäß MiFID II einholen und anschließend einen dreiseitigen „Anlageberatungs- und Verwahrungsvertrag“ mit dem Broker und dem Kunden abschließen. Dieser Vertrag definiert klar den Anlageumfang, die Hebelbegrenzung, die Häufigkeit der Performance-Offenlegung und die Streitbeilegungsverfahren. Manager müssen sich zudem dem Financial Ombudsman Scheme (FOS) anschließen, um sicherzustellen, dass Kundenbeschwerden unabhängig bearbeitet werden können. Die FCA verlangt von MAM-Terminals im Tagesgeschäft, dass sie täglich Details zu Beständen, Bewertungen und Cashflows an das Regulatory Reporting System (REGIS) übermitteln. Jedes Konto mit einer täglichen Nettoinventarwertschwankung von mehr als 5 % löst automatisch eine Untersuchung aus und wechselt damit von der „Verantwortlichkeit nach dem Ereignis“ zur „Intervention während des laufenden Prozesses“.
Nachdem die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) 2021 die Hebelwirkung im Devisenhandel für Privatkunden auf 1:30 begrenzt hatte, nahm sie gleichzeitig PAMM in die Verordnung zur Intervention bei außerbörslichen Derivaten für Privatkunden auf. Diese Verordnung schreibt vor, dass der Fondspool von einer australischen Bank separat verwahrt werden muss und dass täglich eine geprüfte Nettoinventarwertaufstellung (NAV) veröffentlicht werden muss. Wenn ein Manager extern Kapital aufnehmen möchte, muss er zunächst eine AFSL-Lizenz (Agency Fund of Investments) beantragen und einen Prospekt, einen Liquiditätsstresstest sowie einen geordneten Liquidationsplan einreichen. Für professionelle Kunden kann ein Hebelverhältnis von 1:100 beibehalten werden. Umfangreiche Zeichnungs- und Rücknahmedetails müssen jedoch innerhalb von 24 Stunden an die ASIC gemeldet werden, um zu verhindern, dass plötzliche grenzüberschreitende Kapitalabflüsse Marktschocks verstärken. Die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) nutzt die EU-Richtlinie über kollektive Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und stuft MAM-Pools (Managed Asset Management) als „Alternative Investmentfonds“ (AIFs) ein. Dies schreibt die Beauftragung unabhängiger Depotbanken, Verwaltungsdienstleister und Wirtschaftsprüfer für eine dreifache Kontrollstruktur vor. Obwohl die jährlichen Betriebskosten bis zu 8–10 Basispunkte betragen, erhalten die Fonds dadurch EU-weite Vertriebsrechte und können ihre Anteile in 31 Mitgliedstaaten öffentlich anbieten.
Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfolgt einen vorsichtigeren Ansatz: Aggregierte Konten werden gemäß dem Investmentgesetz als „Spezial-AIF“ (Special Asset Management) eingestuft, mit einer Mindestanlagesumme von 1 Million Euro. Sie müssen ein Basisinformationsblatt (KIID) im Bundesanzeiger veröffentlichen. Depotbanken sind verpflichtet, jede gehebelte Transaktion täglich zu überwachen. Übersteigt die Margin-Nutzung 30 % des Nettovermögens, müssen sie die Liquidation einleiten und die BaFin frühzeitig informieren. Die Dubai Financial Services Authority (DFSA) ermöglicht es MAMs (Middle East Regional Funds) über den Rahmen des „Middle East Regional Fund“, sich als „akkreditierte Anlegerfonds“ im Dubai International Financial Centre (DIFC) zu registrieren. Sie legt jedoch weiterhin eine Mindestanlagesumme von 500.000 US-Dollar für Privatkunden fest und verlangt von den Managern sowohl ein CISI-Investmentmanagerzertifikat als auch eine in Dubai ansässige Lizenz als Compliance-Beauftragter. Damit werden die Anforderungen der Offenheit des Finanzzentrums mit der Kontrolle systemischer Risiken in Einklang gebracht.
... Im Gegensatz dazu erlaubt die Klasse-C-Lizenz der Finanzdienstleistungskommission von Vanuatu (VFSC) zwar nominell die „kollektive Vermögensverwaltung“, sieht aber weder Vor-Ort-Prüfungen noch Eigenkapitalanforderungen vor. Jahresberichte erfordern lediglich eine vereinfachte Bilanz und keine Wirtschaftsprüfung. Dieses lasche System verleitet viele Offshore-Broker dazu, Server in Sydney oder Singapur einzurichten und gleichzeitig VFSC-Lizenzen zu nutzen, um Kunden zu gewinnen. Dadurch entsteht eine Grauzone der „Regulierungsarbitrage“ – Gelder verlassen das Land, ohne dass es Rechtsmittel bei Streitigkeiten gibt. Die OECD stufte Vanuatu bereits 2019 als „Hochrisikogebiet“ ein und merkte an, dass die Bewertung zur Bekämpfung von Geldwäsche nur 64 % der FATF-Standards erfüllte. Für Anleger stellt der scheinbar bequeme Zugang zu MAM/PAMM tatsächlich eine Lücke im Schutz ihrer Rechte dar.
Betrachtet man die genannten Jurisdiktionen, wird deutlich, dass etablierte Finanzzentren im Allgemeinen eine dreigleisige Strategie verfolgen: „Lizenzierung + kontinuierliche Offenlegung von Informationen + unabhängige Verwahrung“ für aggregierte Kontomodelle. Sie nehmen hohe Compliance-Kosten in Kauf, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Offshore-Jurisdiktionen ziehen zwar risikofreudiges Kapital durch regulatorische Vorteile an, sind aber im Streitfall machtlos, Rechtsmittel bereitzustellen. Die Wahl des passenden regulatorischen Rahmens für MAM/PAMM ist für Anleger die erste und wichtigste Entscheidung zwischen „Hebelwirkung“ und „Anlagesicherheit“.
Im Bereich des bidirektionalen Devisenhandels gibt es keinen einheitlichen globalen Standard für die Qualifikationsdefinition einzelner Manager im Rahmen der MAM- (Multi-Account Management) und PAMM-Modelle (Percentage Allocation Management) bei Managed-Trading-Services im Devisenhandel.
Der entscheidende Faktor sind die Finanzmarktregulierungsvorschriften des Landes oder der Region des Managers. Gleichzeitig legen die Forex-Broker, mit denen er zusammenarbeitet, zusätzliche Zugangsbedingungen fest, die auf ihren eigenen Risikomanagement-Anforderungen basieren. Dies führt zu erheblichen Unterschieden in den Qualifikationsdefinitionen in verschiedenen Regionen. Die spezifische Definitionslogik lässt sich unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen, regionaler Besonderheiten und impliziter Branchenschwellenwerte eingehend analysieren.
Aus Sicht der zentralen Einflussfaktoren bilden die Regelungen der Aufsichtsbehörden verschiedener Länder die primäre Grundlage für die Definition der Qualifikationen einzelner Vermögensverwalter. Unterschiedliche regionale Regulierungsrahmen legen klare Anforderungen hinsichtlich Qualifikationen und Lizenzen, Kapitalschwellenwerten und Compliance-Dokumenten fest. Auf dem britischen Finanzmarkt gelten für Vermögensverwalter (MAM/PAMM) strenge Qualifikationsanforderungen der Financial Conduct Authority (FCA). Vermögensverwalter müssen die entsprechenden Qualifikationen als Investmentmanager erwerben und eine Reihe weiterer regulatorischer Anforderungen erfüllen. Dazu gehört der Abschluss eines formellen Investmentmanagementvertrags (IMA) mit den Kunden, der den Leistungsumfang, die Aufgabenteilung und die Gewinnverteilung klar definiert. Bei der Verwaltung von Vermögenswerten von Privatanlegern ist zudem die vollständige Einhaltung der britischen Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) erforderlich. Die FCA legt differenzierte Kapitalschwellenwerte für Unternehmen unterschiedlicher Größe fest. Kleine, unabhängige Institute müssen ein Mindestkapital von 75.000 £ nachweisen. Personen, die Kundengelder verwalten, unterliegen höheren Eigenkapitalreserveanforderungen und müssen interne Berichte zur Kapitaladäquanz, Beschreibungen der Organisationsstruktur und weitere Compliance-Unterlagen bei der Aufsichtsbehörde einreichen. Darüber hinaus müssen einzelne Manager mit Kunden und Partnerbrokern eine beschränkte Vollmachtsvereinbarung (Limited Proxy Agreement, LPOA) abschließen, um den Umfang der Autorisierung für die Handelsausführung und die Mittelzuweisung klar zu definieren und unautorisierte oder illegale Transaktionen zu verhindern.
Gemäß dem US-Finanzaufsichtssystem müssen Personen, die als MAM/PAMM-Manager tätig sein möchten, eine von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der National Futures Association (NFA) gemeinsam anerkannte Qualifikation als Commodity Trading Advisor (CTA) erwerben. Dies ist die grundlegende Zugangsvoraussetzung für diesen Beruf. Im Rahmen des Qualifizierungsantrags müssen Manager den Aufsichtsbehörden detaillierte persönliche Informationen zur Verfügung stellen, darunter ihre Sozialversicherungsnummer, ihr Nettovermögen, ihr Jahreseinkommen und weitere wichtige Finanz- und Identitätsdaten. Sie müssen außerdem grundlegende Nachweise wie Identitäts- und Adressnachweis einreichen. Für Schlüsselpersonen, die 10 % oder mehr der Anteile an dem betreffenden Institut halten, müssen ebenfalls Identitätsinformationen und Unterlagen zum beruflichen Werdegang zur Dokumentation eingereicht werden. Zusätzlich zu den Qualifikationsanforderungen legen US-amerikanische Aufsichtsbehörden strenge Offenlegungspflichten für Vermögensverwalter fest. Diese müssen Anlegern die Logik ihrer Handelsstrategien, vergangene Performance-Daten und potenzielle Anlagerisiken wahrheitsgemäß offenlegen. Es ist ihnen strengstens untersagt, Anleger durch das Verschweigen von Verlusten oder das Übertreiben von Renditen irrezuführen. Dadurch werden Transparenz und das Recht der Anleger auf Information gewährleistet.
Auf dem australischen Markt fallen MAM/PAMM-Verwalter in den Bereich der Qualifikationsbewertung für verantwortungsvolle Vermögensverwalter. Die Qualifikationsdefinition konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Kerndimensionen: Fachkompetenz, Berufserfahrung und Compliance-Reputation. Erstens benötigen die Vermögensverwalter einen finanzbezogenen akademischen Hintergrund oder eine anerkannte Branchenzertifizierung. Zweitens müssen sie hinsichtlich der praktischen Erfahrung mindestens mehrere Jahre Erfahrung im Devisenhandel vorweisen. Die Art der Kunden, die sie in der Vergangenheit betreut haben, muss der Art der Kunden entsprechen, die sie zukünftig betreuen möchten. Dies gewährleistet die Fähigkeit, in den entsprechenden Szenarien zu agieren. Schließlich müssen Berater im Hinblick auf ihre Compliance-Reputation sicherstellen, dass sie keine negativen Einträge im Zusammenhang mit regulatorischen Verboten im Finanzsektor, schwerwiegenden Verstößen usw. aufweisen und eine strenge Hintergrundprüfung bestehen. Sie müssen Empfehlungsschreiben aus ihrem Fachgebiet vorlegen, um ihren guten Ruf zu bestätigen. Darüber hinaus verpflichtet die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) Vermögensverwalter zur kontinuierlichen Weiterbildung, um sicherzustellen, dass ihre Fachkompetenz den dynamischen Veränderungen des Marktumfelds und den regulatorischen Vorgaben entspricht.
In einigen Regionen mit weniger strengen Regulierungen schreiben die lokalen Finanzaufsichtsbehörden zwar keine spezifischen Lizenzen für einzelne Vermögensverwalter vor, die Forex-Broker, mit denen sie zusammenarbeiten, legen jedoch auf Basis ihrer eigenen Risikomanagement-Vorgaben Kernschwellenwerte für den Zugang zu Strategien fest und müssen qualifizierte Strategieanbieter sorgfältig prüfen. Einige Broker verlangen von PAMM-Strategieanbietern explizit mindestens sechs Monate durchgehend profitabler Echtgeldhandelskonten sowie ein Portfolio von über 50.000 US-Dollar, um die Stabilität ihres Kapitalmanagements nachzuweisen. Außerdem müssen sie ein detailliertes Antragsformular für ihre Handelsstrategie einreichen, in dem ihre Handelslogik, ihr Risikomanagementsystem und ihre Gewinnziele klar erläutert werden.
Neben regulatorischen Vorgaben und Broker-Vorgaben sind branchenübliche, implizite Qualifikationen wichtige Kriterien zur Beurteilung der Kompetenzen von MAM/PAMM-Managern. Auch wenn sie nicht von den Aufsichtsbehörden vorgeschrieben sind, dienen sie Anlegern und Brokern als zentrale Bezugspunkte. Im Hinblick auf die Performance steht die bisherige Handelshistorie eines Managers im Fokus, insbesondere die Frage, ob er über einen längeren Zeitraum stabile Gewinne erzielt hat und ob seine Risikomanagementfähigkeiten den Standards entsprechen. Quantitative Indikatoren wie die maximale Drawdown-Rate sind entscheidende Bewertungskriterien. Was professionelle Zertifizierungen betrifft, so erhöhen anerkannte Branchenzertifizierungen wie der Chartered Financial Analyst (CFA) und der Chartered Market Technologist (CMT) – obwohl keine gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen – die Glaubwürdigkeit eines Managers am Markt erheblich. Im Bereich der Kontoverwaltung verlangen einige Brokerhäuser von Managern, dass sie Konten mit einem bestimmten Gesamtkapital verwalten, beispielsweise mindestens 10.000 US-Dollar, und dass formelle Vereinbarungen mit Anlegern geschlossen werden, um Gewinnbeteiligungsquoten, maximale Drawdown-Toleranz und andere zentrale Kooperationsbedingungen zum Schutz der Interessen beider Parteien klar zu definieren.
 13711580480@139.com
13711580480@139.com
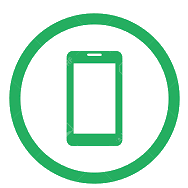 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 z.x.n@139.com
z.x.n@139.com
 Mr. Z-X-N
Mr. Z-X-N
 China · Guangzhou
China · Guangzhou



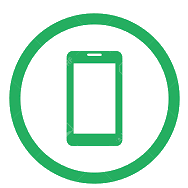 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 Mr. Z-X-N
Mr. Z-X-N
 China · Guangzhou
China · Guangzhou